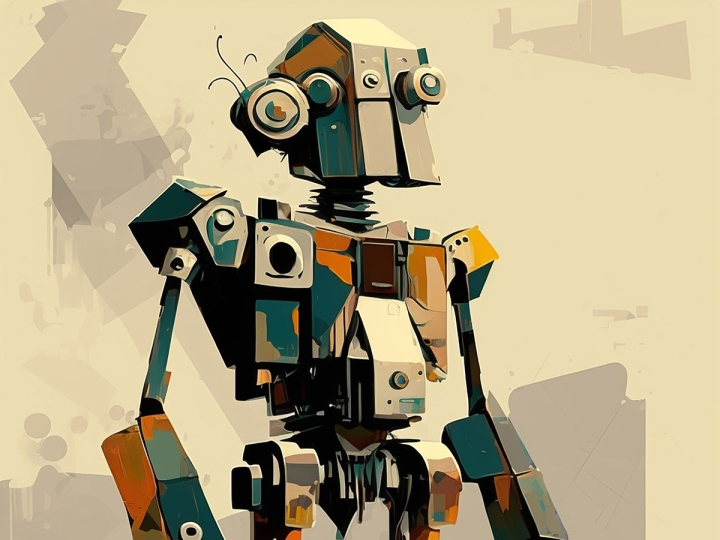
Stellen Sie sich vor, Sie leben im 24. Jahrhundert. Wenn „Star Trek“-Schöpfer Gene Roddenberry mit seiner Einschätzung zukünftiger Technologien wenigstens einigermaßen Recht hatte, dann gehören Holo-Decks in diesem Jahrhundert quasi zur Standardausstattung großer Raumschiffe. Aber vermutlich verfügen auch zivile Einrichtungen wie Bars oder Vergnügungsparks über Räumlichkeiten, die eine alternative Welt abbilden können, die nicht nur verblüffend realistisch aussieht, sondern sich auch so anfühlt. Obwohl sich Phänomene wie aus dem Holo-Deck flüchtende Hologramme oder durch Holo-Patronen verletzte Menschen nur mit viel Fantasie erklären lassen, wird ein anderer, im Grunde ebenso verblüffender Umstand weit weniger häufig diskutiert – nämlich die atemberaubende Geschwindigkeit, mit der die „Star Trek“-Computer diese künstlichen Welten aus dem Boden stampfen. Und das auf Basis von meist nur wenigen Angaben!
Wenn wir also im 24. Jahrhundert durch die Innenstadt einer Metropole wie Berlin, Paris oder New York bummeln und nach Zerstreuung suchen, dann stehen die Chancen nicht schlecht, dass wir schließlich in einem Etablissement mit angeschlossenem Holo-Angebot landen: Dort verraten wir dem Computer, dass wir uns in ein virtuelles Hogwarts wünschen. Oder ins finsterste Mittelalter – direkt zu einem Hexenprozess der Inquisition. Wir könnten uns aber auch dafür entscheiden, den Untergang der Titanic hautnah mitzuerleben, an der Seite von Sherlock Holmes Fälle zu lösen oder einen Piratenschatz zu heben. Doch selbst Szenarien auf der Basis historischer, literarischer und filmischer Dokumente verlangen der Maschine eine Menge „Kreativität“ ab: Vielleicht bekommt sie mithilfe umfangreicher Datenbanken eine ungefähre Ahnung davon, wie Sherlock Holmes’ Wohnung in der Baker Street ausgesehen haben könnte. Oder wie die Titanic aufgebaut war und wie sich der Unfall, der zu ihrem Untergang führte, vermutlich abgespielt hat. Aber spätestens dann, wenn es um Details geht, muss der Computer „frei interpretieren“. Für einen menschlichen Künstler wäre das kein Problem – im Zweifelsfall füllt er die Lücken einfach mithilfe dessen, was wir gerne schwammig als „Inspiration“ oder „Fantasie“ bezeichnen.
Wenn es um Details geht, muss der Computer frei interpretieren
Feuchter Designer-Traum?
Weil wir die genauen Mechanismen hinter Inspiration sowie Kreativität aber noch immer nicht vollständig verstehen, können wir sie schwerlich an ein Programm weitergeben. Jeder Versuch, menschliche Denkprozesse oder künstlerisch-kreative Verhaltensweisen maschinell zu imitieren, beschränkt sich zwangsläufig auf das, was wir selber davon verstehen und was eine Software zu leisten imstande ist. Wenn ein „Star Trek“-Holo-Deck also innerhalb von wenigen Augenblicken eine gesamte Welt erschafft, dann muss es nicht nur über eine märchenhafte Performance, sondern außerdem eine ausgeklügelte „Künstliche Intelligenz“ verfügen – und die wiederum dürfte der feuchte Traum fast jedes Spiele-Herstellers oder Entwickler-Studios sein. Gigantische Spielwelten wie die aus Ubisofts „Assassin’s Creed“-Serie oder Bethesdas „Fallout“-Rollenspielen erfordern jahrelange Fleißarbeit von hunderten Entwicklern und einen enormen Budget-Aufwand, um den digitalen Spielplatz bis zum letzten Winkel zu füllen. Weil man aber unmöglich jeden Grashalm, Baum oder Strauch einzeln pflanzen kann, sind automatisierte Prozesse nötig – Prozesse, die innerhalb Programmierer- und Designer-seitig vorgegebener Parameter arbeiten. Sich selbst überlassen kann man die Maschine aber nicht: Jeder mithilfe solcher Tools gepflanzte Wald, jede Blumenwiese und jedes magisch aus dem Polygon-Boden gewachsene Gebirge wollen überprüft und gegebenenfalls überarbeitet werden. Ergo: Ohne den Menschen geht’s einfach nicht. Noch nicht.
Aber wie toll wäre es, wenn sich all diese lästige und teure Fleißarbeit quasi „von selbst“ erledigen würde? Bevor er das Büro verlässt, drückt der Entwickler das Knöpfchen, nachts rückt die Kolonne aus emsigen KI-Heinzeln an und schon am nächsten Morgen breitet sich eine niegelnagelneue Spielwelt vor ihm aus. Mitsamt rollender Hügel, gurgelnder Bächlein, von plüschigen Wolken eingerahmter Berggipfel und auf saftigen Weiden grasender Wiederkäuer. Fertig ist der neue Spiele-Hit – und dafür hat es kaum mehr gebraucht als ein paar Tassen Kaffee und die Festlegung der Eckdaten, innerhalb derer die KI-gesteuerte Entwicklungsumgebung tätig werden sollte.
Aber mal ehrlich – wäre das wirklich so wünschenswert? Beim Gedanken an derart einfach und günstig zu entwickelnde Spiele bekommen die Damen und Herren in den Chef-Etagen großer Hersteller vielleicht feuchte Augen – aber selbst für all die EAs, Activisions, Ubisofts & Co. würde sich eine solche Entwicklung schnell zum Desaster auswachsen, ist das wichtigste Alleinstellungsmerkmal für diese Firmen doch ihr Kreativ-Kapital. Und ja, damit meinen wir Menschen – solche Menschen, die durch ihre überragenden künstlerischen oder technischen Fähigkeiten echte Ausnahme-Talente in ihren Disziplinen darstellen und die man unbedingt an sich binden sollte. Statt sie wie jederzeit ersetzbare Arbeitsdrohnen zu behandeln. Denn je austauschbarer die kreative Leistung wird, desto beliebiger erscheinen auch die Produkte und können die einzelnen Firmen immer weniger glänzen. Ein Problem, dass durch den Einsatz gleichgeschalteter Design-Automaten weiter zunehmen würde.
Je austauschbarer die kreative Leistung, desto beliebiger die Produkte
Kunstraub im Netz
Trotzdem erleben wir aktuell genau das. Zwar noch nicht im großen Stil, denn die Möglichkeiten der KI-Systeme sind vorerst stark eingeschränkt, aber zumindest in seinen Anfängen. Noch sind es keine leistungsfähigen Game-Engines, die auf Knopfdruck das neue „FarCry“ ausspucken, aber immerhin einzelne Illustrationen, Texte und sogar Musikstücke, die mithilfe stetig leistungsfähigerer AI- oder KI-Software erstellt werden. Auf den ersten Blick erscheint die Arbeitserleichterung und Workflow-Beschleunigung durch auf KI-Lösungen spezialisierte Anbieter wie OpenAi hochinteressant: Synthetisch zusammen geklimperte Symphonien oder mithilfe von KI-basierten Chat-Bots und Zeichen-, Mal- oder Render-Robotern erstellte „Kunstwerke“ erstaunen nicht nur. Sie scheinen vor allem den kreativen Entstehungsprozess zu demokratisieren. Indem sie es auch Neulingen oder gänzlich Kunst-Unfertigen ermöglichen, ihre kreativen Visionen umzusetzen. Wenn auch mit einigen Schönheitsfehlern: So ist der KI-Bebilderer „Midjourney“ dafür bekannt, seinen Charakteren oft unnatürlich viele Finger und Zehen zu verpassen, die nicht selten wie Wurzelgemüse ineinander verschlungen sind. Auch drei anstelle von zwei Beinen und unkontrollierbarer Armwuchs sind bei „Midjourney“ keine Seltenheit – wodurch viele der an sich hochprofessionell wirkenden Motive für den kommerziellen Einsatz unbrauchbar werden.
Natürlich hindert das viele Hobby- und Möchtegern-Illustratoren nicht daran, Social-Media-Plattformen Tag für Tag mit ihren beinahe kreativen Ergüssen zu fluten: Zum Beispiel mit eigenwilligen Interpretationen bekannter Marvel-Charaktere. Dank Kunst-KI wird Spider-Man zum Zombie, trägt Dr. Strange plötzlich eine Rüstung à la Iron Man oder werden alle MCU-Akteure – das funktioniert im Netz immer besonders gut – zu niedlichen Schnurr-Tieren. Oder wie wäre es alternativ mit allen „Herr der Ringe“-Figuren im Look eines russischen Pseudo-Blockbusters, eines Tim-Burton-Puppentrickfilms oder Studio-Ghibli-Streifens? Der Fantasie sind fast keine Grenzen gesetzt: Man muss sich lediglich für den Beta-Test der Software anmelden und den Grafik-Roboter per Chat-Interface (in der Regel „Discord“) mit einigen Textvorgaben füttern, bevor der damit beginnt, aus verknüpften Kunst- und Bilddatenbanken zu „lernen“. Oder weniger freundlich ausgedrückt: jede Menge Bilder zu klauen und daraus etwas Neues zu erschaffen. Naja, mehr oder weniger neu.
Denn wie jeder Mensch ist auch die KI auf Vorlagen angewiesen, um wachsen zu können. Im Grunde sind ihre „Kunstwerke“ am Ende nicht viel mehr als „Remixe“ solcher Motive, die Menschen aus Fleisch und Blut mit viel Schweiß und noch mehr Arbeitsstunden erschaffen haben. Womöglich als Krönung einer viele Jahre dauernden Karriere als Maler, Illustrator, Concept- oder 3D-Artist. Im besten Fall landen solche Motive einfach auf Facebook, TikTok oder Instagram – schlimmstenfalls benutzt sie ein Pseudo-Künstler, um mit ihnen Honorare einzustreichen, von denen der Ersteller der zugrundeliegenden Originale keinen Cent sieht. Zumal „Midjourney“ selber seine Community bereits jetzt üppig zur Kasse bittet: Wer den digitalen Wannabe-Picasso mehr als 25 Bilder pinseln lassen will, der muss mindestens zehn, aber idealerweise sogar 60 Euro pro Monat an das gleichnamige Unternehmen überweisen. Für Marvel-Helden mit Schnurrhaaren oder 18 Gemüsefingern pro Fleischpranke ein stolzer Preis.
Im Grunde sind KI-Kunstwerke nicht mehr als Remixe
Sieht alles gleich aus
Zu den Opfern des aktuellen KI-Hypes zählt zum Beispiel eines der bekannteren Motive aus der Hirn- und Muskel-gesteuerten Feder von Claudya Schmidt – einer Berliner Comic-Künstlerin, besser bekannt unter ihrem Pseudonym „Alector Fencer“. Dank ihrer niedlich illustrierten und traumhaft schön kolorierten „Yria“-Stories (erschienen im Splitter-Verlag) wurde Schmidt zu einer echten deutschen Comic-Berühmtheit. Umso weniger lustig findet sie es, wenn sie heute bekannte Charaktere aus ihren Bildergeschichten in teils nur geringfügig abgewandelter Form im Angebots-Portfolio von KI-„Künstlern“ findet. „Diese Fälle wurden mittlerweile wieder zurückgezogen“, berichtet Schmidt im Gespräch mit IGM. „Trotzdem wird es immer wieder Menschen geben, die versuchen, Geld mit KI-generierten Bildern zu machen. Ein Hauptgrund der aktuellen Neid-Debatte zwischen Künstlern und „Tech-Bros“ liegt dem Geld zugrunde. Viele Menschen scheinen nämlich zu glauben, dass Künstler so was wie elitäre reiche Faulpelze wären. Und mit KI können andere jetzt endlich das gleiche Level erreichen und damit ordentlich Geld verdienen. KI-Generatoren wie „Midjourney“ erlauben es manchen sogar, Comic- und Bilderbücher zu generieren. Privat gehalten ist das sicher eine völlig legitime und sogar tolle Sache, wenn KI es auch vergleichsweise unkreativen Menschen erlaubt, ihre Kopfwelten zu visualisieren. Ich hoffe jedoch, dass sich gerade die Verlage in Zukunft stärker mit dem Thema KI beschäftigen und die Wichtigkeit traditioneller Kunst anerkennen, um auch weiterhin echte Künstler zu beschäftigen. Denn keine KI kann die menschlichen Gefühle ersetzen, die in eine solche Arbeit fließen.“
Weiterhin weiß die Zeichnerin, dass sich die meisten KI-generierten Bilder schnell als solche identifizieren lassen, wenn man erstmal einen „geübten Blick dafür bekommen hat“. „Und gerade weil alles gleich aussieht und einfach zu erkennen ist, wird sich der Hype auch irgendwann im Sande verlaufen“, vermutet Schmidt. Und tatsächlich: Bereits jetzt ist der während der ersten Monate geradezu inflationäre Gebrauch von KI-Motiven deutlich zurückgegangen – das in seinen Qualitäten begrenzte Format scheint sich schnell abzunutzen. Zumal der Widerstand der Künstler-Community immer größer wird: „Vor einigen Wochen wurde eine riesige Sammelklage gegen die größten betroffenen Konzerne eröffnet – darunter Stability AI, Midjourney und DeviantArt“, erklärt uns Claudya. „Sie ist momentan im Gange und sammelt u.a. Beweise tausender Künstler ein. Der Hauptfokus all dieser Klagen und Beschwerden richtet sich aber nicht gegen die KI-Technologie selbst, sondern den Raub des intellektuellen Eigentums sowie dem daraus entstehenden unrechtmäßigen Wettbewerb. Es ist ein ziemlich ermüdender Kampf geworden, sich gegen Kunstraub auszusprechen. Aber noch nie zuvor hat sich die Künstler-Community so zusammengetan, um für eine Gesetzgebung gegen unethische Nutzung ihrer Werke zu kämpfen.“
Böse KI, gute KI
Dabei ist Schmidt selber sogar ausgesprochen Technik-affin: „Natürlich werde ich weiterhin schauen, wie sich diese Technologie entwickelt. Ich rate auch jedem, sich mit dem Thema zu beschäftigen. Vor allem KünstlerInnen sollten informiert bleiben. Je mehr wir das Thema der Ausbeutung in das Bewusstsein der Öffentlichkeit bringen, desto positiver kann sich das auf die Rechte von Kreativ-Arbeitern auswirken. Ich bin aber auch auf die Zukunft gespannt. Vielleicht gibt es ja mal clevere KI-Tools, die uns wirklich bei unserer Arbeit unterstützen.“
Die besten Stichwörter hierfür wären vermutlich „Workflow“ und „Produktivität“: Weil der Überlebenskampf aller Arten von Kreativhandwerkern im Angesicht sinkender Honorare und stetig steigendem Konkurrenzdruck immer härter wird, brauchen sie niemanden, der ihnen das Leben zusätzlich erschwert. Sondern nützliche Werkzeuge, die es ihnen erlauben, ihren individuellen Stil schneller in konkurrenzfähige Produkte zu verwandeln. So können Autoren bereits auf eine reichhaltige Auswahl verschiedener, KI-gestützter Werkzeuge zurückgreifen: Programme wie „Sudowrite“, „Jasper“ oder „Grammarly“ helfen Schriftstellern, Drehbuch-Autoren und sogar Game-Designern dabei, auch dann neue und frische Stories auszuarbeiten, wenn sich die menschliche Ideen-Maschine mal verhakt. Oder sie arbeiten das Manuskript durch und schleifen dessen sprachliche Ecken und Kanten ab. Dabei sollte man allerdings idealerweise auf Englisch texten und selber kompetent genug zu sein, dem Programm auf die Finger zu schauen – denn perfekt sind die KI-Schreiberlinge noch lange nicht. Aber immerhin hilfreich.
Bei Illustratoren sieht das ein bisschen anders aus: Hier ist die KI aktuell eher Feind denn Unterstützer. Obwohl sich vermutlich kaum ein Zeichner, Maler oder Konzept-Künstler gegen einen Software-Helfer wehren würde, der zum Beispiel seine Arbeitsweise und seinen Zeichenstil erlernt, um ihm anschließend Vorschläge zur Verbesserung zu unterbreiten. Oder ihm bei einer besonders knappen Deadline ein wenig Arbeit abzunehmen. „Hey, Du siehst müde aus – leg Dich hin und lass mich die Reinzeichnung fertig machen!“ Klasse, gerne! Oder: „Komm, Du musst bei der neuen Städte-Illu echt nicht jede Bretterbude selber fertig pinseln! Ich habe genau beobachtet, wie Du das machst – jetzt lass mich mal ran und setz Du Dich inzwischen an was Neues!“ Super – wie nett ist das denn bitte?!
So würde ein echter KI-Freund und -Helfer auftreten. Wer dagegen ungefragt die Arbeit eines anderen klaut, um seinen eigenen Algorithmus zu füttern und die Resultate dann in alle Welt zu verscheuern … das grenzt eher an digitalen Kunstraub als an Hilfe.
Schmaler Grat
Kurzum: KI-gestützte Kunst-Versteher und -Helfer könnten sich in gar nicht so ferner Zukunft als Segen erweisen. Aber nur solange, wie sie den Menschen unterstützen. Denn genau dafür wurden Computer und Programme eigentlich entwickelt – um uns den Rücken freizuhalten und die Arbeit zu erleichtern. Nicht, um uns zu ersetzen oder Konkurrenz zu machen. Darüber sollten wir erst dann ernsthaft verhandeln müssen, wenn wir soweit sind, dass Programme die besseren Menschen sein könnten. Beginnen wir aber zu früh damit, Prozesse zu automatisieren, die in ihrer Essenz zutiefst menschlich sind, dann laufen wir Gefahr, dass uns die digitalen Heinzel etwas Wichtiges wegnehmen. Und immer weniger junge Menschen einen Zeichenstift oder Grafik-Pen in die Hand nehmen, um selber echte künstlerische Fähigkeiten zu entwickeln. Und zwar ganz einfach deshalb, weil sie es nicht mehr müssen. Warum Jahre oder Jahrzehnte damit verschwenden, wenn es das Programm auf Knopfdruck macht? Das Resultat wäre eine digitale Kunstwelt, die immer eintöniger und uninteressanter wird, weil es selbst den KI-Tools irgendwann an wahrhaft kreativem Input mangeln würde, den sie aufsaugen und imitieren können. Ohne Referenzen, die es wert sind, kopiert oder interpretiert zu werden, geht eben auch auf dem Holo-Deck – ganz genau – gar nichts. (rb)
Der Autor und Spielegrafik-Versteher Robert Bannert (fertig gepixelt 1974) ist ein Freund des human kontrollierten Digitalismus. Was er damit meint? Dass Macintosh, Konsolen und Kaffeemaschine bei ihm gewaltig Prügel beziehen, wenn sie nicht so wollen wie er. Darum fürchtet Robert nichts so sehr wie die Revolution rachsüchtiger Maschinen.


