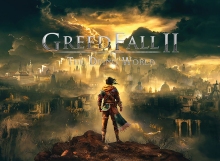IGM: Christian, welches Spiel hat dich in den letzten Jahren – als IP – besonders beeindruckt?
Christian Fonnesbech: Das Reboot von God of War war einfach unglaublich. Santa Monica Studio hat eine alteingesessene IP genommen haben, die im Grunde veraltet war – und hat es geschafft, sie zu modernisieren und zu vertiefen. Plötzlich gab es im Spiel eine persönliche Beziehung zwischen Vater und Sohn. Gleichzeitig blieb diese unglaubliche Leitfigur – der „tentpole character“ – bestehen, und das Spiel hat das gewürdigt, worum es in der IP schon immer ging: den Zorn gegen die Götter. Aus IP-Sicht hat man also alles richtig gemacht. Aber natürlich standen dafür auch Hunderte Millionen Dollar zur Verfügung.
IGM: Welches Spiel mit geringerem Produktionsbudget hat dich – aus IP-Sicht – beeindruckt?
Fonnesbech: Das neue Indie-Game RV There Yet? hat IP-Potenzial. Der Markenname des Spiels ist einprägsam - er lässt an Kinder auf dem Auto-Rücksitz denken, die sich beschweren. Es ist ein Low-Budget-Indie-Game, aber es sieht wirklich einzigartig aus. Man kann die Key Visuals selbst auf einem zwei mal zwei Zentimeter kleinen Thumbnail erkennen. Auch die Stimmung des Spiels ist einzigartig – das Ganze fühlt sich sofort wie ein potenzielles IP-Franchise an. Wie ich hörte, ist RV There Yet? auch ein großartiges Spiel, aber darum soll es hier nicht gehen. Aus IP- und Markensicht geht es darum, ob es sich im Markt abhebt. Kann man es – als geistiges Eigentum – besitzen? Kehren die Menschen immer wieder zu dem Spiel zurück, weil sie diese emotionale Erfahrung nur hier bekommen? RV There Yet hat im IP-Markt einen neuen Raum geschaffen, von dessen Existenz wir zuvor nicht einmal wussten. Darum geht es bei Franchises, die auf IPs basieren. Aber jetzt müssen sie daraus Kapital schlagen.
IGM: Was genau macht den Art Style von RV There Yet? einzigartig?
Fonnesbech: Der Stil ist äußerst schlicht, dennoch vermittelt er Figuren mit Emotionen und Haltungen – und er sticht hervor. Die Hauptfigur hat eine wirklich sehr kleine Sonnenbrille, ist ein bisschen übergewichtig und trägt einen seltsamen Hut. Im Computerspielmarkt gibt es keine andere Figur, die so aussieht. Entertainment-Franchises sind ja überwiegend auf eine Leitfigur aufgebaut – man denke nur an Lara Croft, Link, Super Mario, James Bond, Batman und so weiter. RV There Yet? macht genau das von Anfang an richtig. Expedition 33 ist darin ebenfalls sehr gut: Es hat eine einzigartige Story, tiefgründige Figuren und eine emotionale Reise.
IGM: Funktioniert IP-Aufbau vor allem mit einer Leitfigur – oder geht das auch mit mehreren Figuren?
Fonnesbech: Ensembles werden selten zu Franchises. In der Theorie klingt das Vorhaben zwar gut. Aber schauen wir uns Overwatch an – das ultimative Beispiel für den Versuch, ein Ensemble-Franchise zu erschaffen. Aber die einzige Figur, an die sich jemand erinnert, der kein Hardcore-Fan ist, ist Tracer. Obwohl Blizzard Entertainment Millionen Dollar für die Entwicklung von mehr als 40 Figuren ausgegeben hat, erinnert man sich letztlich nur an eine. Ich glaube nicht, dass das menschliche Gehirn besonders gut darin ist, Ensembles zu verarbeiten. Und natürlich geht es auch um rechtliche Schutzfähigkeit. Es ist schon schwierig genug, eine einzige Figur unverwechselbar und ikonisch zu gestalten. Das gleich mit fünf oder mehr Figuren zu versuchen, grenzt an Größenwahn. Das ist einfach zu ambitioniert.
Ensembles werden selten zu Franchises
IGM: Nun haben wir über Games gesprochen, deren IP Building dich beeindruckt hat. Welche haben dich so gar nicht beeindruckt?
Fonnesbech: Wenn man nach Negativbeispielen sucht, redet man meist über Spiel Nummer zwei. Beim ersten Spiel weiß man ja noch nicht, ob das Unternehmen überhaupt am Aufbau einer IP interessiert ist. Als Negativbeispiel sehe ich Hades. Das erste Hades ist ein fantastisches Spiel – und das zweite auch. Aber wenn man die Hauptfigur wechselt, schwächt man die IP. Es ist so, wie wenn man einen James-Bond-Film über James‘ Schwester machen würden – oder ein Tomb-Raider-Game über Laras Bruder. Wer würde dafür etwas bezahlen? IPs und Franchises leben ganz von Vertrautheit: KonsumentInnen kehren für dasselbe emotionale Erlebnis zurück.. Wenn du das nächste Harry-Potter-Buch kaufst, erwartest du, dass Harry wieder zur Schule geht, gemobbt wird und so weiter. Das ist in allen sieben Büchern so. Und Lara Croft sucht auch nach 29 Jahren immer noch in den Ruinen nach ihrem Vater. Ihre Figur verkörpert diese ganz spezielle emotionale Reise. Als Inhaber einer Entertainment-IP baut man auf die Vertrautheit der Hauptfigur auf. Das ist das Wesentliche, was einem gehört – das geistige Eigentum des Franchise.
IGM: Supergiant Games ist bei Hades 2 von diesem Prinzip abgewichen ...
Fonnesbech: Ja, sie sind von Zagreus als Hauptfigur zu seiner Schwester Melinoë gewechselt. Das mag politisch korrekt und aus Sicht des Studios das Richtige sein. Ich bin auch der festen Überzeugung, dass wir mehr weibliche Hauptfiguren brauchen – und weniger mittelalte weiße Männer! Aber wenn man Erwartungen an ein Franchise mit einer bestimmten Figur etabliert hat, schwächt ein Wechsel der Figur die Vertrautheit im Markt. Bei Hollow Knight mag das etwas anders aussehen. Auch da haben sie die Hauptfigur gewechselt. Aber die Figuren in Hollow Knight sind so einzigartig und visuell markant, dass ich mir nicht sicher bin, ob die Leute den Unterschied überhaupt merken – es sieht immer noch aus wie Hollow Knight. Aus einer reinen IP-Sicht wäre ich allerdings bei der ursprünglichen Figur geblieben.
IGM: Wie sieht es bei RPGs aus, bei denen SpielerInnen die Figur selbst aufbauen?
Fonnesbech: Schauen wir uns Bloodborne an, mein persönliches Lieblingsspiel: Niemand hat einen Character, der wie die Figur auf dem Cover aussieht. Dennoch weiß man genau, wer das ist. Das Studio hat also eine tragende Figur erschaffen, die nicht dem spielbaren Avatar entspricht – und das Ganze funktioniert als Franchise mit einer klaren emotionalen Reise. Diese Figur lässt sich im rechtlichen Sinne besitzen – man kann mit ihr einen Film machen oder auch ein weiteres Game. Und es ist sehr schwierig, etwas anderes als eine Figur zu besitzen. Man kann keinen Art Style oder eine Spielmechanik besitzen – und die Technologie, die man verwendet, veraltet mit der Zeit. Auch die Spielwelt lässt sich nicht schützen, weil sie zu groß und zu amorph ist. Das geht aber mit einer Figur, die ein besonderes visuelles Design hat – und mit der man spezielle Gefühle und Erinnerungen verbindet. Als IO Interactive verkauft wurde, machte Agent 47 den größten Teil des Unternehmenswerts aus – obwohl die Firma insgesamt vier verschiedene Spieleserien produziert hatte.
IGM: Eine Spielwelt ist rechtlich kaum schützbar, sagst du. Inwieweit kann sie aber zu einer IP beitragen?
Fonnesbech: Für den Aufbau einer IP gibt es mehrere Bausteine. Je mehr Bausteine man hat, desto stärker und kohärenter wird die IP. Die Leitfigur ist einer dieser Bausteine, die Spielwelt ein anderer, die Marke ein dritter und so weiter. Worldbuilding eignet sich ausgezeichnet, um Atmosphäre und Immersion zu erzeugen. Man denke nur an Warhammer 40K – dessen Worldbuilding ist einzigartig und emotional stark. SpielerInnen, mich eingeschlossen, wollen sich in diesem Spiel bedeutungslos fühlen, zerquetscht von mechanischer Infanterie – und das Ganze auch noch mit Dämonen und Space Marines. Oder schauen wir uns Dune oder The Lord of the Rings an: Ihre Welten – und die Stimmungen, die diese erzeugen – sind genauso ikonisch wie ihre Figuren. Aber das bedeutet nicht, dass sich diese Welten vor Gericht schützen lassen – denn das Gesetz braucht etwas Konkretes, das es schützen kann.
Für den Aufbau einer IP gibt es mehrere Bausteine
IGM: Was macht man eigentlich eine Spielwelt interessant und glaubwürdig – und damit zu einem möglichen IP-Baustein?
Fonnesbech: Das hängt oft damit zusammen, wie wir die Realität wahrnehmen: Wir nehmen die reale Welt in Fragmenten wahr, die wir dann selbst zusammensetzen. Wir kennen nicht die komplette Geschichte des Untergangs der Titanic – aber wir setzen diese Geschichte aus Hunderten von verschiedenen Quellen zusammen: mündlichen Erzählungen, Nachrichten, Schulmaterialien und so weiter. Das ist auch das Geheimnis großartigen Worldbuildings in Games: Die SpielerInnen sollten nie das große Ganze sehen können. Es muss tief und fragmentiert sein – und größer als das, was man sieht. Mach die Welt zu einem vielschichtigen und faszinierenden Ort mit einer spannenden Hintergrundgeschichte, aber lass die SpielerInnen die Welt in ihren eigenen Köpfen zusammensetzen. Geheimnisse sind ein Feature, kein Bug.
IGM: Wie eine archäologische Ausgrabung, bei der man Schicht für Schicht freilegt …
Fonnesbech: Genau. FromSoftware sind Meister darin. Jedes Mal, wenn man in Dark Souls oder Bloodborne ein Item findet, erhält man ein weiteres Fragment der Geschichte dieser Welten. Das erzeugt Authentizität: Die Welt fühlt sich größer an als das, was man sieht. So ist es bei der realen Welt ja auch.
IGM: Wann sollten Firmen beginnen, ihre IP aufzubauen – und was sind dabei die wichtigsten Schritte?
Fonnesbech: Idealerweise schon vor der Finanzierung des Spiels. Es verbessert den Pitch enorm, wenn man ein potenzielles Franchise pitcht. Ein Gameplay-Loop ist natürlich notwendig, aber ein Gameplay-Loop plus potenzielles Franchise ist etwas ganz Anderes – Investoren werden da viel mehr Vorteile sehen. Der Sweet Spot, sich damit intensiv zu beschäftigen, liegt normalerweise in der Pre-Production, also im Anschluss an die Finanzierung, aber vor der eigentlichen Entwicklungsphase. Man muss eine klare Vorstellung von der IP haben, bevor man die Pre-Production abschließt! Ohne eine klare Vision von den Figuren und ihrer emotionalen Reise fliegt man blind: Man hofft darauf, dass sich das „organisch“ über einen Zeitraum von drei oder vier Jahren ergeben wird. Wir beobachten, dass das sehr oft zu Problemen führt.
Geheimnisse sind ein Feature, kein Bug
IGM: Die da wären?
Fonnesbech: Deine Welt, die Figuren und die Marke werden dann oft generisch, weil man in dem Zeitraum Millionen Entscheidungen unter Druck trifft – und weil Konsens in der Regel den Mittelweg bedeutet. Am Ende stellt man dann fest, dass das Spiel genauso aussieht wie alle anderen Zombie- oder Piratenspiele – oder zu sehr wie Overwatch. Wenn man das erst zu einem späten Zeitpunkt der Entwicklung bemerkt, ist es zu spät, um noch etwas zu ändern. Dann kämpft man darum, sich im Markt hervorzuheben. Vielleicht fehlt auch die emotionale Bindung – oder die IP ist vor Gericht nicht schützbar. Und dann hat man ein großes Problem.
IGM: Wie lässt sich diese Sackgasse vermeiden?
Fonnesbech: Wir helfen unseren Kunden, sehr früh eine Vision von ihrer IP zu entwickeln. Aber dafür braucht es wirklich eine gemeinsame Sprache. Viele Studios können wunderbar über Code und Game-Mechaniken sprechen – aber sie tun sich scher damit, über Figuren, Emotionen oder die Marktpositionierung zu sprechen. Sie sehen das nicht als ihr eigenes Problem – so lange, bis es zu spät ist. Entwicklerteams brauchen eine Sprache für das, was eine großartige Figur ausmacht, was eine emotionale Reise ausmacht, was die Konkurrenz gerade tut – und wie man sich von ihr abheben kann, ohne die Core-Fans des Genres zu verlieren. Wenn Studios keine Sprache dafür haben, wird das Ganze subjektiv, nach dem Motto: „Ich mag dies – und ich mag jenes nicht.“ Dann gibt es im Team keine qualifizierte Diskussion. Einer unserer wichtigsten Jobs ist es, den Teams zu helfen, eine solche gemeinsame Sprache zu entwickeln – so dass sie ausdrücken können, was sie erschaffen wollen. Aus IP-Sicht sollte das so früh wie möglich passieren.
IGM: Wenn Firmen euch um Rat fragen, was sind da die ersten Schritte?
Fonnesbech: Normalerweise beginnen wir mit einem IP-Sprint. Das sind drei kurze Meetings, in denen wir die Herausforderungen und Chancen erörtern. Also: Gibt es in diesem Spiel überhaupt eine IP? Etabliert es eine emotionale Verbindung? Hebt sie sich im Markt ab? Was muss eventuell geändert werden, damit sich das auch juristisch schützen lässt? Diese Sessions sind schnell und effektiv. Kleineree Firmen belassen es dabei, weil ihr Budget begrenzt ist. Aber manchmal machen wir mit Coaching und Mentoring weiter: Wir schauen regelmäßig vorbei, um sicherzustellen, dass das Projekt Fortschritte macht.
IGM: Wie geht es dann weiter?
Fonnesbech: Der nächste Milestone ist meistens, einen Prototyp für die IP und die Marke zu erstellen. Ja, man muss tatsächlich für beides einen Prototyp erstellen! Game-Devs sind sehr gut im Prototyping von Gameplay und Technologie – aber nicht darin, einen Prototyp für die emotionale Reise oder Ähnliches zu erstellen. Dies muss so früh wie möglich in allgemeiner Form geschrieben, entwickelt und entschieden werden. Das Gleiche gilt für die Hauptfigur und für die Spielwelt. Das muss in der Anfangsphase noch nicht fertig sein – aber es muss eine klare Vision und eine klare Absicht geben: Was möchte man erschaffen?
Normalerweise beginnen wir mit einem IP-Sprint
IGM: Die emotionale Reise der Hauptfigur muss also vorab skizziert werden ...
Fonnesbech: Genau, und zwar nicht im Detail, sondern strukturell. Also: Wie verläuft die emotionale Entwicklung? Wohin steuert die Geschichte? Wo liegen die Hindernisse? Welche Emotionen sollen bei den SpielerInnen geweckt werden – und in welcher Reihenfolge? Sobald das klar ist, kann sich das Team darauf einigen, was es eigentlich erschaffen will. Spieleentwicklung ist komplex: Es gibt Level-Designer, Combat-Designer, Artists, Sound-Designer und mehr. Wenn früh Klarheit herrscht, eint das. Wir empfehlen zudem, einen Prototyp der Marke zu erstellen.
IGM: Das bedeutet?
Fonnesbech: Da gilt es, sich verschiedene Fragen zu stellen: Wie wollen wir das Produkt auf dem Markt positionieren? Mit welchen Key Visuals, Logos und Versprechen? Was müssen wir den SpielerInnen sagen, damit sie sich zum Kauf entschließen? Wenn man das frühzeitig anpackt, wird man gezwungen, die Essenz des Spiels klar zu formulieren – und wenn man das hat, kann man es damit vergleichen, was die Konkurrenz verspricht. Gibt es zum Beispiel noch zehn andere Piraten-Games, stellen sich Fragen wie: Was versprechen die? Und versprechen wir selbst den Genre-Fans genügend „pirateness“ – und unterscheiden uns gleichzeitig ausreichend von der Konkurrenz, um unsere Existenz zu rechtfertigen? Das sollte für jedes Team ein unverzichtbarer Milestone in der Vorproduktion sein.
IGM: Was passiert danach?
Fonnesbech: Wir fungieren oft als IP-Wächter – gewissermaßen als Sparringspartner – und überprüfen gemeinsam mit dem Team, ob die vom Team entwickelte IP- und Markenvision umgesetzt wird. Schlussendlich helfen wir dann auch manchmal beim Marken-Design, also bei Key Visuals, Logos und Kommunikation – und stellen so sicher, dass deren Botschaft sowohl die IP als auch das Gameplay widerspiegeln. Außerdem arbeiten wir mit Accelerators zusammen, zum Beispiel Games London, Interactive Ontario und Press Start in Berlin.
IGM: Worum geht es in dieser Accelerator-Tätigkeit?
Fonnesbech: Wir halten Masterclasses, Vorträge und individuelles Mentoring für Startup-Teams. Momentan betreuen wir 132 Teams in Deutschland und Kanada – das machen wir jetzt seit sechs Monaten, und es ist faszinierend. Mit einem 200-Personen-Studio zu arbeiten ist aufregend, aber kleine Teams können schneller die Richtung ändern. Große Teams sind wie Schiffe, die manchmal auf einen bestimmten Kurs festgelegt sind. Es kann richtig Spaß machen, mit einem kleinen Team zu arbeiten, das auf der Stelle wenden kann.
IGM: Wie stark ist der Widerstand in solch großen Firmen, AutorInnen eine führende Rolle zuzugestehen?
Fonnesbech: Das ist ein großes Problem. Ehrlich gesagt versteht die Games-Industrie immer noch nicht wirklich, was Schreiben eigentlich bedeutet. AutorInnen werden viel zu oft wie Schreibkräfte behandelt. Wir müssen uns ziemlich oft mit diesem Thema auseinandersetzen. Wenn man frühzeitig eine IP-Vision entwickeln möchte, müssen AutorInnen oft von Anfang an in den kreativen Prozess eingebunden werden. Das bedeutet aber, dass Teams lernen müssen, wie man mit AutorInnen kommuniziert. Die DNA der Games-Industrie besteht aus Code und Game-Design – daher sind die meisten Teams es nicht gewohnt, über Emotionen, Charaktere oder die Struktur einer Geschichte zu diskutieren. Tatsächlich haben viele Teams sogar Angst davor – vielleicht weil sie befürchten, dass ihnen dadurch ihre kreative Freiheit genommen wird. Diese Angst hat einen sehr hohen Preis: Man zahlt ihn am Ende der Entwicklung, wenn man feststellt, dass das Spiel wie alle anderen Zombie-Spiele aussieht, die diese Woche auf den Markt kommen. Ohne Kenntnisse bei Worldbuilding und Storytelling bleibt das Feedback, das AutorInnen erhalten, subjektiv.
IGM: Das Einbeziehen der Community gewinnt in der Spieleproduktion immer mehr an Bedeutung. Kann das den Aufbau einer IP auch stören?
Fonnesbech: Es kommt auf dein Ziel an. Wenn dein Ziel ein Kunstprojekt mit Community-Beteiligung ist: Prima, dann lass die Community die kreativen Entscheidungen treffen! Wenn du aber eine kohärente und kommerziell tragfähige IP haben willst, dann ist Community-Beteiligung oft eine ziemlich furchtbare Idee. Denn man braucht ja eine klare Vorstellung – und da passt es nicht, wenn kreative Entscheidungen aus allen möglichen Richtungen kommen. Es sei denn, dass das Projekt darin besteht, in alle möglichen Richtungen zu gehen – in diesem Fall ist es nicht Entertainment, sondern Kunst.
IGM: Was kann KI zum IP-Aufbau beitragen?
Fonnesbech: Meiner Erfahrung nach eignet sich KI hervorragend für Prototyping. Wenn man weiß, was man erreichen will, kann KI helfen, dieses Ziel schnell zu erreichen. KI ist jedoch in erster Linie ein Verstärker: Wenn man etwas gut kann, macht KI einen besser – oder zumindest schneller. Wenn man etwas aber nicht gut kann, wird das auch von KI verstärkt. Wenn man nicht weiß, was man will – oder wie etwas funktioniert, was man will –, wird man mittelmäßige Ergebnisse erzielen: Eben deshalb, weil man nicht weiß, wie man danach fragt. Das Ergebnis wird nicht originell sein, sondern bestenfalls durchschnittlich.
IGM: Im Produzieren von Mainstream-Inhalten ist KI ja ziemlich gut ...
Fonnesbech: Ich würde das so nicht sagen. Den Mainstream zu bedienen ist etwas sehr Schwieriges – frag jeden, der dem auch nur annähernd nahegekommen ist. KI ist gut darin, durchschnittliche Inhalte zu produzieren – was aber etwas ganz anderes ist; es sei denn, man ist Arthouse-Liebhaber und hält alles Mainstreamige ohnehin für Durchschnitt – aber das ist wieder ein anderes Argument. Grundsätzlich ist die Grenze wischen „durchschnittlich“ und „originell“ fließend. Reine Originalität ist von Natur aus fremdartig – sie ist Kunst, Avantgarde und spricht nur ein kleines Publikum an. Es stimmt, dass der Mainstream keine absolute Originalität haben will - er will eine neue Version von etwas Vertrautem, die ihn dennoch überrascht. Aber genau das ist keineswegs einfach umzusetzen! Und sich auf KI zu verlassen, um eine neue Version von irgendetwas zu schaffen, ist ein Rezept dafür, im Einheitsbrei zu versinken: KIs sind Maschinen des Durchschnitts – und Durchschnitt fällt nicht auf und überrascht nicht. (Achim Fehrenbach)
Please welcome … Mai-Vy Thach, PR Manager Central Europe, Capcom Entertainment Germany…