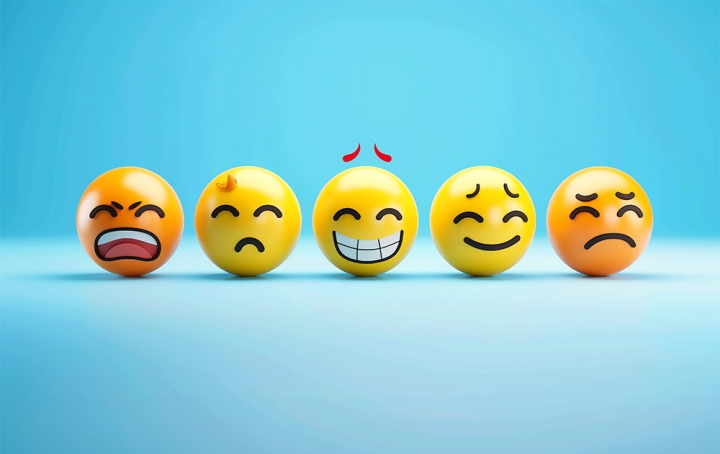
Ende April fand das Internationale Trickfilm-Festival Stuttgart statt. Das ITFS mag zwar in erster Linie ein Stelldichein der Animationsfilmbranche sein – allerdings werden dort auch besonders innovative Computerspiele prämiert. Den „Animated Games Award Germany“ erhielt in diesem Jahr das Computerspiel Closer the Distance, das gerade in den Hamburger Osmotic Studios entsteht. „Closer the Distance spricht die Spielenden auf ungewöhnlich sensible Art an und schafft dabei den Spagat zwischen Narrative und Gameplay“, heißt es in der Urteilsbegründung der ITFS-Jury. „Die unterschiedlichen Charaktere lassen uns den komplexen Trauerprozess begleiten und auf wunderschöne Weise erleben, wie viel ein einzelnes Leben bei anderen beeinflusst.“ Das Spiel habe einen Nachhall hinterlassen, „der länger trägt als die Geschichte selbst“, so die Jury. „Und wir freuen uns darauf, das fertige Spiel spielen zu können.“
Distanziertes Dorfleben
Bekannt geworden sind die Osmotic Studios mit ihren beiden Games Orwell: Keeping an Eye on You (2016) und Orwell: Ignorance is Strength (2018). Beide sind brillante Überwachungsthriller, die SpielerInnen in die Rolle eines Big Brother versetzen. Closer the Distance – es soll dieses Jahr erscheinen – geht allerdings in eine ganz andere Richtung. Aus der Perspektive der verstorbenen Angela blicken wir auf ihr Heimatdorf Yesterby. Angela stellt fest, dass sie das Verhalten einiger DorfbewohnerInnen zumindest noch mittelbar beeinflussen kann – merkt aber auch, wie schwierig es wird, den Wünschen aller BewohnerInnen gerecht zu werden. „Closer the Distance ist eine Slice-of-Life-Simulation, die eine zutiefst emotionale Geschichte über die Verbindungen zwischen Familie und Freunden im Angesicht einer Tragödie erzählt“, heißt es in der Kurzbeschreibung des Spiels. „Bring lang gehütete Geheimnisse ans Licht, behebe Beziehungsprobleme und hilf deinen Lieben, weiterzumachen.“
Closer the Distance spricht ernste Themen an – und ist damit in der Games-Landschaft längst nicht mehr die Ausnahme. „Für dramatische, aus dem Leben gegriffene Geschichten, die auch Themen wie Verlust und Trauer behandeln, gab es in anderen Medien wie Büchern oder Filmen schon immer eine Zielgruppe“, sagt Daniel Marx, Geschäftsführer und Game Director der Osmotic Studios. „Der Tod ist ein Teil des Lebens, und früher oder später bekommt jede und jeder einen persönlichen Bezug dazu.“ Marx wundert es also nicht, dass immer mehr Games solche Themen ansprechen. „Schon seit einigen Jahren kann man eine starke Diversifizierung im Games-Bereich beobachten“, sagt er. Sowohl die Spieleentwicklung als auch das Medium Games würden immer zugänglicher, die Dev-Scene werde immer größer und diverser. „Damit einher geht auch, dass SpielerInnen in Games nach neuen Themen suchen, die die volle Breite an zwischenmenschlichen Geschichten abdecken. Und damit eben auch ein ernstes Thema wie Trauerbewältigung.“
Die volle Breite an zwischenmenschlichen Geschichten
Komplexe Emotionen
Ganz ähnlich sieht das der Psychologe Nicolas Hoberg. „Die Bandbreite der emotionalen Erfahrungen, die durch Spiele exploriert werden, ist heute sehr viel breiter als früher“, sagt er. „Besonders im Indie-Bereich gibt es Games, die sehr komplexe Emotionen ausloten.“ Als Beispiel nennt er That Dragon Cancer, in dem ein Vater den Krebstod seines Kindes verarbeitet: „Das sind hochkomplexe Gefühle, aber auch innere Prozesse, wie sich Gefühle über die Zeit verändern.“ Mit seinen KollegInnen Jessica Kathmann und Benjamin Strobel hat Hoberg die Plattform Behind the Screens gegründet, um psychologisches Wissen für die Games-Branche verfügbar zu machen – und zwar über Podcasts und Blogposts, Vorträge, Workshops und Beratung für Spielefirmen (vgl IGM 05/2024).
In ihren Beiträgen analysieren die drei ExpertInnen längst nicht nur Indie-Games, sondern auch AAA-Titel wie Final Fantasy oder Zelda. Den Erfolg von Spielen wie Dark Souls und Elden Ring erklärt Hoberg beispielsweise damit, dass es den Machern gelungen sei, „Bedürfnisse vieler Spielenden nach Kompetenz und Selbstwirksamkeit erfolgreich zu befriedigen“. Oder anders formuliert: Die Spielenden erleben, dass sie etwas schaffen können, wenn sie sich nur richtig reinknien. „Das ist eine Erfahrung, die manche vielleicht selten im Alltag machen“, sagt Hoberg. „Sie nutzen dabei Kompetenzen, die sie gar nicht in ihr Selbstbild integriert hatten.“ In der Corona-Zeit wiederum beobachte Hoberg einen Trend zu Cozy Games: „Die soziale Isolation in der Pandemie hat bei vielen Menschen das Bedürfnis nach Sicherheit, Rückzugsräumen, Entschleunigung und Entspannung verstärkt.“ Überhaupt seien Games gerade in Krisen erstklassig zur Emotionsregulierung geeignet, betont Hoberg. Erst kürzlich hat Behind the Screens einen Beitrag für die Bundeszentrale für politische Bildung verfasst, der sich um Games und Resilienz dreht. Ganz nach dem Motto: Können digitale Spiele uns widerstandsfähiger machen?
Verzerrte Ergebnisse
Trotz deutlicher Fortschritte steht die psychologische Games-Forschung vor erheblichen Herausforderungen. „Die Grundfrage ist: Was geht im Kopf einer Person vor?“, bringt es Hoberg auf den Punkt. „Um das herauszufinden, kann ich mich bei Playtests verschiedener Methoden bedienen, zum Beispiel Befragungen.“ Allerdings seien sich manche Spielenden gar nicht so genau darüber im Klaren, was sie gerade fühlen. Ein weiteres Problem von Befragungen ist, dass direkte Antworten sozialen Verzerrungen unterliegen können. „Vielleicht antwortet die Person so, wie sie es für sozial erwünscht hält“, sagt Hoberg. Ähnliches gelte auch für Fragebögen oder Games-Tagebücher. Weil Selbstzuschreibungen oft schwammig und verzerrt sind, setzt die Forschung auch auf Körpersignale – zum Beispiel Hautleitwert, Herzrate, Blutdruck, Pupillendilatation oder Mikroexpressionen im Gesicht. Dahinter steckt die Annahme, dass sich Körpersignale nicht so leicht fälschen lassen, dass der Körper gewissermaßen nicht lügt. „Leider stellt uns dann jedoch die zuverlässige Interpretation dieser Körperdaten vor sehr große Herausforderungen“, schränkt Hoberg ein. Als Beispiel nennt er den Hautleitwert: „Der misst relativ zuverlässig die Erregung – allerdings ist diese Erregung ohne Kontextinformationen sehr schwierig zu deuten.“
Bedürfnisse vieler Spielenden nach Kompetenz und Selbstwirksamkeit
Womöglich kann künstliche Intelligenz dazu beitragen, genauer in die Köpfe der Gamer zu blicken. Zu den führenden Forschern auf diesem Gebiet zählt Georgios N. Yannakakis (vgl. IGM 05/2024): Er ist Professor am Institute of Digital Games der University of Malta und beschäftigt sich seit vielen Jahren mit dem Thema „Emotionen und Games“. In seiner Forschung verfolgt Yannakakis auch stark datengetriebene Ansätze, bei denen die sogenannte Computer Vision zum Einsatz kommt. „In meinem Team versuchen wir, uns nur auf die Pixel auf dem Bildschirm und Interaktionsgeräusche zu verlassen“, sagt er. „So könnten Computer-Vision-Systeme – wie etwa Convolutional Neural Networks – auf den Bildschirm schauen, zugleich den Ton aufzeichnen und aus all dem schließen, wie sich die Spielenden gerade fühlen.“ Der Forscher vergleicht das Ganze mit einem Spiegelbild – nur eben einem der Gefühle.
Veränderung zählt
Das klingt sehr spannend, aber auch sehr experimentell. Treten wir also einen Schritt zurück, um das Ganze besser zu beleuchten. Der Antrieb für Yannakakis‘ Methodensuche resultiert aus der Unzufriedenheit mit den gängigen Methoden. „In User Experience Labs werden oft Likert-Skalen verwendet, um komplexe Phänomene wie Emotionen zu messen“, berichtet er. „Man bittet also die Benutzer, einen Wert zwischen 0 und 10 anzugeben – je nachdem, wie gefesselt sie sind. Aber diese Werte sind nicht zuverlässig, weil sie eine Menge subjektiver Verzerrungen und Protokollierungsfehler enthalten.“ Ein Punkt also, den auch Nicolas Hoberg bemängelt hatte. Yannakakis hält einen anderen Ansatz für deutlich ergiebiger: „Wenn man Menschen befragt, welche Erfahrung sie bei einem bestimmten Videospiel hatten, zählt vor allem die Veränderung. Also zum Beispiel, ob ein bestimmter Level-Abschnitt fesselnder ist als ein anderer.“ Yannakakis und KollegInnen haben deshalb Theorien, Methoden und Werkzeuge entwickelt, die auf der sogenannten „ordinal nature of emotions“ basieren. „Sie messen – über die Zeit hinweg – die relativen Veränderungen, die es bei subjektiven Zuschreibungen gibt“, sagt Yannakakis. „Zum Beispiel bei Emotionen, Vorlieben, Meinungen und Stilen von SpielerInnen.“ Untermauert wird dieser Ansatz durch neurowissenschaftliche Studien: Diese belegen, dass unser Gehirn Werte jeglicher Art – subjektiv oder nicht – auf relative Weise kodiert.
Zuverlässigere Modelle der Player-Emotionen
Doch wie lässt sich das in der Praxis umsetzen? Nun, Yannakakis startete ein Forschungsprojekt, in dem sein Institut mit der Firma Ubisoft kooperiert. Konkret beobachtet die Forschergruppe Probanden beim Spielen von Tom Clancy‘s The Division 2. „Wir nehmen Videos davon auf und bitten die Leute dann, das Video durchgehend zu kommentieren, während sie ihr eigenes Gameplay betrachten“, erläutert der Forscher. „Dann verarbeiten wir die Daten, die sie uns zur Verfügung gestellt haben. Dabei interessieren wir uns nur für die Veränderungen des Engagement, die Veränderungen der Spannung. Mit dieser Methode erhalten wir zuverlässigere Modelle der Player-Emotionen.“ Will heißen: Was die SpielerInnen über ihre Anspannung berichten, lässt sich erst dann richtig einordnen, wenn es im Querschnitt des Spiels betrachtet wird.
Lehrer und Schüler
In seiner Forschung bringt Yannakakis auch immer mehr KI zum Einsatz. Ziel ist, Modelle zu trainieren, die das Gamer-Verhalten möglichst zuverlässig voraussagen können – was wiederum eine Anpassung des Spielerlebnisses ermöglicht. „Normalerweise werden Player-Modelle offline im Entwicklungsstudio erstellt“, sagt Yannakakis. „Sobald man die Modelle hat, können diese in der Produktion verwendet werden, um das Spiel zu testen oder auszubalancieren. Das Spiel kann gegebenenfalls sogar im laufenden Betrieb angepasst werden.“ Der Knackpunkt ist: Im Labor stehen Daten zur Verfügung, die beim Spielen im Wohnzimmer nicht erfasst werden – also zum Beispiel Daten von Eye-Trackern und Herzfrequenzmessern. Wie also lassen sich diese präzisen Daten nutzen, um das Verhalten von „unbeobachteten“ SpielerInnen in den Wohnzimmern vorherzusagen? Um dieses Problem zu lösen, hat Yannakakis KI-Modelle für „privilegierte Informationen“ entwickelt. „Es gibt ein Modell, das wir das ‚Lehrermodell‘ nennen“, erläutert der Forscher. „Dieses Modell weiß im Grunde alles über die SpielerInnen. Außerdem haben wir ein kleineres ‚Schülermodell‘, das sich nur auf – sagen wir mal – Frames des Gameplay stützt.“ Beide Modelle werden nun parallel trainiert, so Yannakakis: Dabei gibt der „Lehrer“ nach und nach einen Teil seines Wissens an den „Schüler“ weiter – und zwar so, dass der „Schüler“ schlussendlich auch im Wohnzimmer arbeiten kann. „Eine Reihe von Games hat bewiesen, dass wir das Niveau der Genauigkeit und Zuverlässigkeit des Modells beibehalten können“, freut sich Yannakakis, „und zwar selbst dann, wenn das Schülermodell keinen Zugang zu Gesichtsausdrücken und all dem hat.“ Yannakakis spricht hier von einer Genauigkeit um die 80 Prozent – ein durchaus beeindruckender Wert.
Halten wir also fest: KI-Modelle wie die beschriebene „Wissensdestillation“ können helfen, das Verhalten von Gamern besser vorauszusagen – und so deren Emotionen im Spiel zu steuern. Auch angesichts solcher technologischen Fortschritte bleibt die ureigene Aufgabe jedes Game-Designers erhalten: Spiele zu entwickeln, die uns fesseln und begeistern. (Achim Fehrenbach)
Meine erste größere Reise außerhalb Europas ging vor fast 30 Jahren nach Thailand.…


